Einführung, normative Grundlage
Teil 4 von 5: Die ISO Norm 9001:2015 stellt im Kapitel 7.1.6 „Wissen der Organisation“ im ersten Satz folgende Anforderung:
Die Organisation muss das Wissen bestimmen, das benötigt wird, um ihre Prozesse durchzuführen und um die Konformität von Produkten und Dienstleistungen zu erreichen.
Mit diesem Blogbeitrag möchten wir nicht das klassische Wissensmanagement zum Umgang mit Wissen erklären, sondern einige wesentliche Punkte und Hintergründe zum Wissensmanagement beleuchten. So zum Beispiel, wie sich das Wissensmanagement im prozessorientierten Umfeld einsetzen lässt.
Wissen als strategischer Faktor
Bei dieser Betrachtung macht es Sinn, wenn wir einen zusätzlichen Blick auf die Entwicklung von Unternehmensstrategien werfen. Dem NSGMM (Neues St. Galler Management-Modell) ist beispielsweise zu entnehmen, dass die sogenannten Kernkompetenzen eine grundlegende strategische Stossrichtung darstellen. Kernkompetenzen können kurz als relevante Wissensinhalte der Organisation bezeichnet werden. Die oberste Stufe der Relevanz bildet dabei das „überlebenswichtige“ Know-how (Wissen) einer Organisation.
Wie im IOZ-Blogbeitrag über Rollen nach AKV-Methodik beschrieben, umfasst die Kompetenz sowohl Befähigungen wie auch Befugnisse. Mit der Befähigung sind Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeint, um Wissen ergebnisorientiert einzusetzen.
Herkunft des Wissens gemäss ISO
Von welchem Wissen ist konkret die Rede, wenn es heisst „Wissen der Organisation“? Die ISO Norm 9001:2015 gibt Hinweise durch folgende 2 Anmerkungen:
Anmerkung 1: Das Wissen der Organisation ist das Wissen, das organisationsspezifisch ist; es wird im Allgemeinen durch Erfahrung erlangt. Es sind Informationen, die im Hinblick auf das Erreichen der Ziele der Organisation angewendet und ausgetauscht werden.
Anmerkung 2: Das Wissen der Organisation kann auf Folgendem basieren:
a) auf internen Quellen (z. B. geistiges Eigentum, aus Erfahrungen gesammeltes Wissen, Lektionen aus Fehlern und erfolgreichen Projekten, Erfassen und Austausch von nicht dokumentiertem Wissen und Erfahrung, die Ergebnisse aus Verbesserungen von Prozessen, Produkten und Dienstleistungen);
b) auf externen Quellen (z. B. Normen, Hochschulen, Konferenzen, Wissenserwerb von Kunden oder externen Anbietern).
Grundsatz: Wissen wird in der Norm unter Ressourcen behandelt. Wissen ist daher eine Ressource, die mit dem Lernen und den Erfahrungen der Belegschaft anfällt.
Abgeleitet von den bisherigen Feststellungen kann der ideale SOLL-Zustand ungefähr so aussehen:
Zum Zeitpunkt, wenn der Akteur spezifisches Wissen benötigt, muss es in einer Form verfügbar sein, in welcher es ergebnisorientiert eingesetzt werden kann.
Wissen im prozessorientierten Umfeld
Wissen, was getan werden soll
Der Umgang mit Wissen könnte im prozessorienterten Umfeld mit der Frage beginnen, was zu tun ist. Da Organsiationen Ziele haben, muss die Frage damit beantwortet werden, durch welche Aktivitäten und Vorgänge die Ziele erreicht werden können. Ziele können dabei langfristig (Vision), mittel- oder kurzfristig sein. Die Festlegungen, auf welche Art die Ziele erreicht, überwacht und bei Bedarf korrigiert werden sollen, wird Strategie genannt. Im Zentrum steht der Anspruch, die richtigen Dinge zu tun. Die Umsetzung der Strategie geschieht anhand operativer Vorgänge innerhalb von Managementsystemen mittels Projekten und Prozessen (Prozesslandschaft).
Wissen, worauf man achten soll
Bei Prozessen können Anforderungen an deren Einflussfaktoren bestehen. Aber ebenso können auch Anforderungen an die Ergebnisse bestehen (Produkte oder Dienstleistungen). Es blicken Parteien mit verschiedenen Interessen und somit aus verschiedenen Perspektiven auf die Handlungsweisen des Akteurs bzw. auf die Ergebnisse.
Das benötigte Wissen hängt darum auch von der Branche ab, in der eine Organisation tätig ist (Kontext der Organisation). Der Kontext der Organisation umschreibt also auch die Rahmenbedingungen für Prozesse, Ergebnisse und deren Umfeld.
Je nach Branche ist das Umfeld mehr oder weniger stark reguliert. Dies ist abhängig, ob und wie streng bindende Verpflichtungen bestehen (durch Gesetze, Marktregeln, Betriebsauflagen durch Behörden, etc.). Deshalb muss der Akteur wissen, „worauf“ zu achten ist. Er muss hierzu Wissen und Bewusstsein erlangen, welche Aspekte durch seine Handlungen und deren Ergebnisse betroffen sind bzw. wo er Schäden verursachen bzw. vermeiden kann. (Aspekte können sein: Gesetzeseinhaltung, Zufriedenheit mit Ergebnissen, Reputation, Ressourcenschonung, Umweltschutz, Sicherheit, Gesundheit, usw.).
Wissen, wonach man sich richten soll
Wenn der Akteur weiss, worauf zu achten ist und er das nötige Bewusstsein über Schadschöpfung bzw. Schadensvermeidung hat, dann muss er wissen, „wonach“ er sich richten soll, um an die Informationen für das richtige Handeln zu kommen.
Hierzu kann sich der Akteur nach anerkannten Regeln richten, um eine richtige (konforme) Handlungsweise zu erlangen. Verschiedene Normen und Leitlinien gelten als anerkannte Regeln und erleichtern die Akzeptanz von Tätigkeiten, Produkten und Dienstleistungen. Ebenso schaffen sie eine fundierte Vertrauensbasis bei Auftraggebern und auf dem Markt. Normen werden aus Gründen der wirtschaftlichen Selbstregulierung nicht von Gesetzgebern erstellt, sondern durch die interessierten Kreise selbst.
Je nach Aspekt (Qualität, Umweltschutz, Arbeitssicherheit, etc.) bestehen anerkannte Regeln, unter anderem aus ISO-Normen. Nach diesen kann man sich richten, wenn man den entsprechenden Aspekt konform handhaben möchte. Die Handhabung geschieht anhand von Managementsystemen mit unterschiedlichen Ausprägungen:
Deckt ein Managementsystem nach ISO 9001:2015 die grundlegenden Qualitätsanforderungen an Produkte und Dienstleistungen ab, so müssen Managementsysteme nach ISO 13485 spezifische Anforderungen aus dem Bereich der Medizinprodukte und Managementsysteme nach IATF 16949 zusätzlich spezifische Anforderungen aus der Automobilbranche abdecken. Das Normenwissen und das Bewusstsein über Folgen der Nichterfüllung sind also im prozessorientierten Umfeld von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit.
Mit dem Normenwissen hat man Beschreibungen der Eigenschaften von Systemen, Prozessen, Produkten oder Dienstleistungen. Normen stellen Anforderungen, was zu erfüllen ist, geben aber nur Empfehlungen und Lösungsansätze dafür, wie etwas zu erfüllen ist.
Wissen, wann (bis wann) etwas getan werden soll
Die Zeitachse ist ein weiterer Einfluss-Faktor. Das Wissen um den richtigen Zeitpunkt und die Dauer eines Vorgangs können einen Vorgang erheblich beeinflussen. Ein ideales Ergebnis sollte zur rechten Zeit und innerhalb der erwarteten Dauer zustande kommen.
Wissen, wo etwas getan werden soll
Schon bei der Kontext-Analyse einer Organisation ist der Ort des Geschehens ein wichtiger Einfluss-Faktor. Umgebungsbedingungen oder Veränderungen von Umgebungsbedingungen durch Ortswechsel können sowohl für Vorgänge wie auch für Ergebnisse bestimmte Einflüsse oder sich ändernde Einflüsse bedeuten. Ebenfalls können Vorgänge und Ergebnisse sich auf bestimmte oder sich ändernde Umgebungen auswirken. Das Wissen über Einflüsse auf oder von Umgebungen wird relevant bei Themen wie Zonen (ATEX, ESD, Gefahrenstofflager, Gefahrengut, Gefahrenzonen, örtliche Regulierungen CE, UL, FDA, etc.) und bei Personen (Sprachbarrieren, Jetlag, Kulturunterschiede, etc.).
Wissen, wer etwas tun soll
Die Person bzw. der Akteur ist ein Einflussfaktor, welcher eingehend im Blogbeitrag Rollenkonzept nach AKV besprochen wurde. Der Akteur, selber Träger von Wissen und Entscheidungskraft, stellt bei vielen Vorgängen das grösste Risiko dar, aber auch die grösste Chance. Als Befähigter und Befugter Akteur sollte es dem ihm möglich sein, das Wissen ergebnisorientiert einzusetzen.
Wissen, womit etwas getan werden soll
Das Wissen über den Einsatz gewählter Ressourcen und Einsatzmittel betrifft die Wahl der richtigen Mittel wie auch den optimalen Einsatz. Auch die Tauglichkeit und Verfügbarkeit sind ein zentrales Thema bei diesem Einflussfaktor. Der Umgang mit Ressourcen ist weitgehend verzahnt mit den Anwendern und dem Nutzen. Fähigkeiten und Fertigkeiten, um mit den Ressourcen möglichst ergebnisorientiert umzugehen, sind Teil der Kompetenz bzw. der nötigen Befähigung von Akteuren. Ressourcen unterliegen oft Verschleisserscheinungen, Störungen und können dadurch negativen Einfluss auf die erwarteten Ergebnisse von Vorgängen haben.
Wissen, wie etwas getan werden soll (Know-how, Methodenkompetenz)
Um eine Normanforderung zu erfüllen, muss sie in eine wirksame und organisationsspezifische Form transformiert werden. Eine Form unterstützt die Art und Weise, wie etwas getan wird. Idealerweise wäre es eine effiziente und effektive Erzeugung von Ergebnissen. Einige Formen, in welchen spezifisches Wissen in der Praxis häufig eingesetzt wird, sind am Ende des Blogbeitrags aufgelistet. Da sich das Know-how als wichtiger Bestandteil des Wissens in der Kernkompetenz niederschlägt, werden wir im Folgekapitel nochmals tiefer darauf eingehen. Wie etwas getan werden soll, sollte möglichst umsichtig geschehen. Deshalb sind Wissen, Kompetenzen, Verfügbarkeit und Bewusstsein über die vorangegangenen Einflussfaktoren im prozessorientierten Umfeld von Bedeutung und idealerweise einzubeziehen. Wenn eine Methode alle Faktoren angemessen berücksichtigt, ist die Chance gross, die erwarteten Ergebnisse zu erhalten.
Das Management der Einflussfaktoren hat eine Bandbreite von „so gut wie nötig“ bis hin zu „so gut wie möglich“.
Wissen in „Form“ bringen
Erinnern wir uns nochmals kurz, wie der ideale SOLL-Zustand aussehen könnte:
Zum Zeitpunkt, wenn der Akteur das Wissen benötigt, muss es in einer Form verfügbar sein, in welcher es ergebnisorientiert eingesetzt werden kann.
Ebenfalls haben wir festgestellt, dass mit Befähigung die Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeint sind, um Wissen ergebnisorientiert einzusetzen.
Wenn wir dies zusammenfassen, dann können wir zum Schluss kommen, dass eine Form des Wissens so gestaltet werden kann, dass die benötigte Befähigung enthalten ist. Wenn der Akteur also die persönliche Befähigung nicht hat, ist der Vorgang durch begleitende Informationen soweit ausgestattet, dass der Akteur durch sie befähigt wird. Ein gutes Beispiel hierfür sind Anleitungen, die uns oft im Alltag befähigen, ein uns unbekannter Vorgang ergebnisorientiert zu bewältigen.
Natürlich sollte die Art und Weise, wie das Wissen eingesetzt wird, im entsprechenden Umfeld geprüft werden (z.B. Methoden-Validierung).
Die Formen sind vielfältig, wie Wissensinhalte, Informationen und Erfahrungen zum Einsatz gebracht werden können. Wenn die Kompetenz in Form der nötigen Befähigungen und Befugnissen mitgegeben werden kann (siehe auch Rollenkonzept mittels AKV), dann könnte man von einer integrierten Methoden-Kompetenz sprechen.

Abbildung: Aussage ist, dass der Einflussfaktor wie (Wie wird’s gemacht?) ein Resultat aus dem Wissen, den Erkenntnissen und Erfahrungen der Organisation sowie dem Bewusstsein der Belegschaft darstellt.
Das Resultat wird dem Akteur in einer Form zur Verfügung gestellt, mit welcher ein effektiver und effizienter Vorgang ermöglicht wird. Allenfalls sind Kompetenzen bezüglich Befähigung und Befugnis integriert.
Begriffe rund um das Wissen
Im Zusammenhang mit dem Begriff Wissensmanagement sieht man häufig verschiedene Formen von Wissen:
- Strukturiertes Wissen
- Unstrukturiertes Wissen
- Explizites Wissen
- Implizites Wissen
- SECI-Modell (wird hier nicht behandelt)
- Probst-Modell (wird hier nicht behandelt)
Strukturiertes Wissen
Im prozessorientierten Umfeld wird das Wissen anlässlich eines Ablaufes eingesetzt. Das bedeutet, dass beim entsprechenden Prozessschritt ein bestimmtes Wissen vorhanden sein muss. Ist das Wissen direkt und nur in diesem Prozessschritt anwendbar, so ist das Wissen Bestandteil des Prozesses (Einflussfaktor „Wie“) und somit Bestandteil der Prozessstruktur. Insofern spricht man im Kontext des prozessorientierten Umfeldes von strukturiertem Wissen.
Unstrukturiertes Wissen
Wissen, welches man in strukturierter Form vorfindet, weil es nur anlässlich eines spezifischen Vorgangs eingesetzt wird, kann sich durchaus auch für weitere Vorgänge oder Prozesse eignen. In der Vergangenheit sind auf diese Weise schon etliche Wissensinhalte, Methoden, Formulare, die ursprünglich sehr spezifisch eingesetzt worden sind, zu einem prozess- oder bereichsübergreifenden Einsatz gekommen. Solche Wissensinhalte können dann in einer Prozessstruktur immer wieder eine oder mehrere Ebenen höher steigen, bis sie letztendlich für jedermann in der Belegschaft einsetzbar sind. Eine Methode, welche es vom spezifischen Einsatz (KVP: kontinuierlicher Verbesserungsprozess) bis in die Ebene von Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen und in alle Prozesse geschafft hat, ist der PDCA-Regelkreis (auch Deming-Kreis genannt). Solche Wissensinhalte werden dann als unstrukturiertes Wissen und als Allgemeingut der Organisation bereitgestellt und abgelegt. Sofern eine Formalisierung entfällt, wird der Inhalt möglichst einfach und anwenderfreundlich gestaltet.
Wissen, welches die oberste Leitung als Allgemeinwissen innerhalb der Organisation voraussetzt, sollte ebenfalls als unstrukturiertes Wissen im Unternehmens-Wiki abgelegt werden.
Explizites und implizites Wissen
Wenn das im entsprechenden Prozessschritt benötigte Wissen als Wissensinhalt schriftlich festgelegt ist, dann spricht man im Kontext des prozessorientierten Umfeldes von explizitem Wissen. Hinweis: Wissen, das in den Köpfen der Belegschaft vorhanden ist, nennen wir im prozessorientierten Umfeld implizites Wissen.
Ob und inwieweit solches implizites Wissen als Ressource bei Lösungs- und Ideenfindung verwertbar ist, muss durch die Organisation selbst geprüft und mit den entsprechenden Wissensträgern vereinbart bzw. geregelt werden. Es geht dabei schliesslich auch um die Forderung, geistiges Eigentum herauszurücken.
Ergebnisorientierter Einsatz von Wissen
Anhand eines Praxisbeispiels aus dem Alltag möchten wir die vorgestellten Konzepte und Ansätze veranschaulichen:
Bestimmt kennen Sie das eine oder andere Lebensmittelprodukt, bei dem Sie den Eindruck haben, dass es noch genau gleich schmeckt, wie in Ihrer Kindheit.
Ein solches Produkt wurde über all die Jahre so hergestellt, dass immer der gleiche Geschmack entstanden ist. Hauptsächlich ist also das Wissen über die richtige Mischung dafür verantwortlich, also das spezifische „wie wird’s gemacht“.
Stünde hier keine strenge Regulierung dahinter, etwa in Form einer genau dosierten Rezeptur, dann würde das Produkt immer wieder anders schmecken.
Wenn aber ein Erzeugnis auf dem Markt erfolgreich ist, dann wollen die Kunden das Produkt so. Der Hersteller muss also darauf achten, dass er die erfolgreiche Rezeptur und all die wichtigen Parameter nicht verliert, um immer gleichbleibende Qualität auf dem Markt sicherstellen zu können.
Ein solches Wissen ist dann eine Kernkompetenz, von welcher nicht selten die Existenz einer Organisation abhängt und hinter welcher oftmals sogar patentrechtliche Bemühungen stehen, um das Wissen zu schützen.
In den meisten Organisationen geht es mit dem Wissen nicht ganz so weit, dennoch ist es wichtig, dass das relevante und existentiell wichtige Wissen für ergebnisorientierte Vorgänge / Abläufe nicht nur in den Köpfen der Belegschaft besteht (implizit), sondern für alle involvierten Akteure jederzeit und dauerhaft in gültiger Form verfügbar ist.
Formen in der Anwendung
Je nach Ausgestaltung der Form ist die Befähigung mehr oder weniger integriert.
Methoden / Best Practices:
Dies sind bewährte Vorgehensweisen, um gewünschte Ergebnisse zu erhalten. Methoden oder Best Practices können mehrere der nachfolgenden Formen beinhalten.
SOP:
Wenn das im entsprechenden Prozessschritt benötigte Wissen einem bestimmten formalen Ablauf folgen muss, dann wird es formalisiert. Es bedeutet, den Wissensinhalt in anweisender Form festzuhalten. Diese Art der Formalisierung nennt man üblicherweise Standard Operating Procedure (Standardvorgehensweise) – kurz SOP. Abläufe von SOP sind zwingend in der Reihenfolge einzuhalten.
Arbeitsanweisung:
Dies ist eine weniger strenge Form und wird hauptsächlich für interne Vorgänge in den Prozessen beigestellt.
Formular:
Durch ein Formular erhält der Akteur nicht nur Informationen, sondern wird auch aufgefordert, Informationen zu geben bzw. Aufzeichnungen zu machen.
Guide / App:
Hier wird der Akteur durch Vorgänge geführt. Die Führung kann dabei passiv oder in Form von einer Interaktion mit dem Akteur geschehen. Bei interaktiven Guides wird der Akteur zu Eingaben aufgefordert.
Trouble-Shooting-Liste:
Hier wird der Akteur durch eine bestimmte Struktur – einen „Fehlerbaum“ – geführt, um für bestehende Probleme oder Störungen mögliche Lösungsansätze zu finden. Die Ansätze beruhen vielfach auf bereits gemachten Erfahrungen (lessons learned).
Check-Liste:
Hier wird der Akteur zu Vergleichen zwischen IST und SOLL aufgefordert. Idealerweise sind gleich Massnahmen genannt, wenn das IST nicht dem SOLL entspricht.
Programme / Parameter / Setups:
Hier läuft der Vorgang durch automatisierte Akteure ab (Maschinen, Roboter, etc.). Das Wissen ist in Form einer Logik und anhand von Parametern vorgegeben. Rückmeldungen erhält das „Hirn“ durch die Sensorik, um Bedingungen von weiteren Abläufen zu schaffen.
Fazit
Wissen im Unternehmen ist eine der wertvollsten Ressourcen. Dieses Wissen ist entweder bereits vorhanden oder wird erworben (externe Beratung, Weiterbildung von Mitarbeitenden oder Anstellungen von Spezialisten usw.). Ziel eines jeden Unternehmens sollte es sein, sein Wissen so verfügbar zu machen, dass darauf jederzeit zugegriffen werden kann. Lösungen für Wissensmanagement unterstützen Unternehmen dabei, das Wissen bestmöglich sicher- und bereitzustellen.
Wer sich nach der neuen ISO-Norm zertifizieren lassen will, muss sich mit der Thematik auseinandersetzen. Doch ist „müssen“ – also ein externer Zwang – eigentlich das komplett falsche Wort: Sollte es nicht im Interesse eines jeden Unternehmens sein, sich mit dem Wissensmanagement zu befassen und so das eigene Unternehmen voranzubringen?
Weitere Blogbeiträge über die neue ISO-Reihe
Dies ist der vierte Beitrag unserer 5-teiligen Blogreihe zum Thema „Neue ISO-Normen“.
1. Beitrag: praxisnah und modular
2. Beitrag: PDCA-Regelkreis
3. Beitrag: Rollenkonzept mit AKV-Methodik
5. Beitrag: Risikobasiertes Denken im Managementsystem implementieren

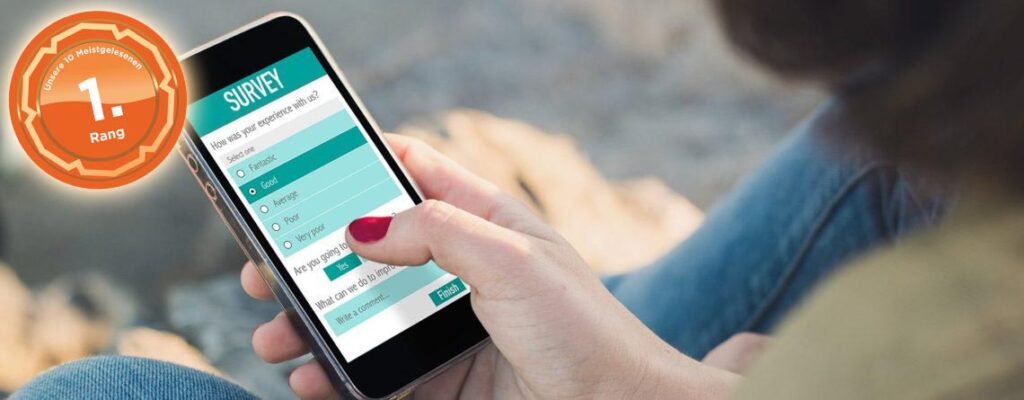




Beitrag teilen